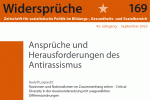Bildung & Wissenschaft
Human Genome Editing
Internationale Abwägungen zu Keimbahnveränderungen
Die „Genschere“ CRISPR-Cas ermöglicht genetische Veränderungen schneller als jemals zuvor. Während die ersten Patient*innen mit CRISPR-Therapien behandelt werden, wird über Keimbahneingriffe international noch diskutiert. Ihre Anwendung birgt ein hohes technologisches und gesellschaftliches Risiko.
Inhaltsverzeichnis Schwerpunkt: https://www.gen-ethisches-netzwerk.de/publikationen/gid/268
Vielfalt, aber kein Durcheinander
Anarchistische Gesellschaftsentwürfe
Der Untertitel verspricht sehr viel. Man könnte meinen, dass in diesem Buch eine zusammenhängende Theorie des Anarchismus vorgelegt wird. Glücklicherweise beugt der Haupttitel diesem Eindruck von vornherein vor, kündigt er doch an, dass es um Gesellschaftsentwürfe geht.
„Die Kinder gehen jetzt zur Schule“
Aspirationen, Entwicklungsdiskurs und Schulbildung in Lodwar, Nordkenia von 1989-2022
Professorale Freiheit oder reaktionärer Kulturkampf?
Das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit
Seit 2021 existiert mit dem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit ein professoral dominierter Zusammenschluss von Wissenschaftler*innen, die in den Medien lautstark die Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit durch linken Aktivismus beklagen. Christiane Fuchs wirft in ihrem Beitrag einen genaueren Blick auf das Personal und die Tätigkeiten des Netzwerks.
„Das jeweils relevante gemeinsame Dritte finden…“ Rassismuskritik und/oder Antirassismus? Nachdenken über ein erkenntnispolitisches Feld
Widersprüche, Heft 169, 43. Jg. 2023, Nr.3, 45-62
Proprietarismus*: Eine neue Form von Faschismus?
Es gibt keinen „Anarchokapitalismus“ oder Rechts„libertarismus“
Es kann keinen „Anarchokapitalismus“ geben, weil dies ein Widerspruch in sich wäre. „Anarchismus“, An-Archos, heißt Herrschaftslosigkeit oder Herrschaftsfreiheit und Kapitalismus kann nicht herrschaftsfrei sein.
Zweite Wissenschaftskultur
Der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik und die nachfolgende Transformation der ostdeutschen Gesellschaft, ihre Integration und Subordination in die Bundesrepublik, betraf auch die Wissenschaft. Dies hatte insbesondere für die Gesellschaftswissenschaften in der DDR einschneidende Folgen. Diese lassen sich für die Institutionen mit den Begriffen Abwicklung, Schließung, Auflösung, Auslöschung und Umstrukturierung beschreiben.
Arbeitsrechte für alle
Darf der Blick aus 2023 auf die Streiks von 1973 ein nostalgischer sein? Das Kapital hat daraus gelernt...
Im Oktober 2023 erinnerte Thorsten Bewernitz in der GWR 482 an die „wilden“ Streiks 1973. Der folgende Artikel von Mag Wompel zeigt auf, dass diese Streiks auch deshalb so bedeutend waren, weil damals in vielen Betrieben erstmals internationale und geschlechterübergreifende Solidarität geübt wurde. Diese gelte es wieder zum Leben zu erwecken. (GWR-Red.)
Handlungsfeld duales Studium
Ist das duale Studium - also ein akademischer Qualifizierungsweg, der das Studium an einer Hochschule mit einer Berufsausbildung bzw. umfangreichen Praxisphasen in einem Unternehmen bezeichnet - mehr als eine süddeutsche Besonderheit im deutschen Hochschulsystem? Isabella Albert gibt einen Einblick.