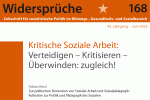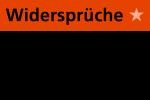Die Sámi in einer umkämpften Arktis
Aktuelle Herausforderungen für Selbstverwaltung und Autonomie
Die rechtlichen und politischen Regelungen für die Selbstverwaltung der Sámi sind in Finnland seit langem umkämpft. Darüber hinaus schließen sich nach den geopolitischen Turbulenzen, die durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine ausgelöst wurden, zunehmend wertvolle internationale Räume für Zusammenarbeit und Beteiligung.